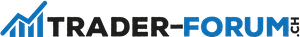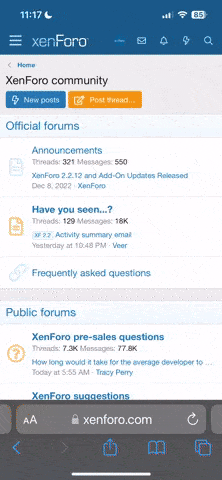Interessanter Artikel. Was haltet Ihr davon? ... schon noch krass, das hätte ich jetzt nie erwartet. Wird wohl schlimme Auswirkungen haben punkto zukünftige Geldgeber. Eine Präsidentin, die eigenmächtig handelt.
Kirchner in den Fussstapfen von Hugo Chávez
Argentiniens Regierung wechselt von Fine-Tuning zu kruden Staatseingriffen
Mit zunehmendem Interventionismus versucht Argentiniens Präsidentin, ihr Wirtschaftsmodell zu retten. Die Zukunft des teilverstaatlichten Erdölkonzerns YPF ist mit Fragezeichen behaftet.
Werner Marti, Buenos Aires
Mit der zum Wochenbeginn von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner angekündigten Teilverstaatlichung von YPF, dem grössten argentinischen Erdölkonzern, übernimmt der argentinische Staat zusammen mit den Erdölprovinzen 51% der Aktien des Unternehmens. YPF fällt damit zwanzig Jahre nach der Privatisierung wieder zurück an den Staat. Der 51%-Anteil wird in seiner Gesamtheit vom spanischen Erdölkonzern Repsol, der bisher eine Aktienmehrheit von 57,4% besessen hatte, enteignet. Die Interessen der übrigen Aktionäre - die Unternehmerfamilie Eskenazi hält via Grupo Petersen 25,4%, der Rest wird an der Börse gehandelt - werden nicht angetastet.
Übernahme im Handstreich
Repsol hat inzwischen eine Entschädigung von 10,5 Mrd. $ verlangt. Die Börsenkapitalisierung von YPF Ende Januar vor Beginn der Kampagne der Regierung gegen das Unternehmen lag bei 17 Mrd. $. Die Regierung hat die Forderung von Repsol zurückgewiesen und erklärt, bei der Festsetzung der Kompensation würden die fehlenden Investitionen in YPF berücksichtigt. YPF ist bereits in fester Hand der Regierung, obwohl das Gesetz zur Verstaatlichung im Kongress noch nicht verabschiedet worden ist.
Die Präsidentin hat kurzerhand auch die sofortige Zwangsverwaltung von YPF dekretiert. Noch während sie über die nationalen Fernsehsender die Teilverstaatlichung bekanntgab, übernahmen im noblen früheren Hafenviertel Puerto Madero Vertreter der Regierung den Hauptsitz des Unternehmens und räumten laut Presseberichten zwanzig Mitgliedern der Unternehmensführung ganze 15 Minuten Zeit ein, um das Gebäude mit ihren wichtigsten Habseligkeiten zu verlassen. Bis auf weiteres wird YPF jetzt von Planungsminister de Vido sowie vom stellvertretenden Wirtschaftsminister Kicillof geleitet. Der Planungsminister wird in Argentinien von vielen für die gegenwärtige Energiekrise verantwortlich gemacht. Der 40-jährige Kicillof, der in der konservativen Tageszeitung «La Nación» kürzlich als Marxist bezeichnet wurde, hat keine Erfahrung auf dem Erdölbereich. Er ist aber einer der einflussreichsten Berater der Präsidentin. Jüngst hatte diese proklamiert, YPF werde in Zukunft professionell geführt werden.
Wie sich immer klarer zeigt, geht der Schaden der Teilprivatisierung weit über die direkt betroffene Repsol hinaus. Die YPF-Aktien wurden in New York am Mittwoch nach zweitägigem Unterbruch wieder gehandelt und verloren 32,7%. Das Papier hat somit seit Ende Januar, als die Kampagne der Regierung begann, rund 70% seines Werts eingebüsst. Dies trifft insbesondere auch eine Reihe von institutionellen Anlegern aus den USA hart, was wohl erklärt, weshalb Washington nach anfänglich lauer Reaktion seinen Ton verschärft hat. Das Länderrisiko Argentinien hat am Mittwoch die Grenze von 1000 Basispunkten überschritten; der Zinszuschlag auf argentinischen Staatspapieren im Vergleich mit amerikanischen Treasury-Bonds stieg mit anderen Worten auf 10,5 Prozentpunkte.
Schwer in Bedrängnis kommt auch die argentinische Familie Eskenazi, die über den Grupo Petersen 25,4% der YPF-Aktien hält. Unter starkem Druck von Präsident Néstor Kirchner trat Repsol in zwei Schritten 2008 und 2010 diesen Anteil an die Eskenazi-Familie ab. Zur Finanzierung der Übernahme nahm diese Kredite in der Höhe von 3,4 Mrd. $ zu gleichen Teilen bei Repsol und bei einem internationalen Bankenkonsortium auf, dem gemäss der «Nación» auch die Credit Suisse angehören soll. Den Schuldendienst bezahlten sie jeweils aus den Dividenden von YPF. Nachdem die Regierung nun angekündigt hat, dass für 2011 keine Dividende ausbezahlt werde, weil man in das Unternehmen reinvestieren solle, befindet sich der Grupo Petersen in akuter Konkursgefahr. Sie schuldet Repsol laut Bloomberg noch 1,9 Mrd. $ und dem internationalen Bankenkonsortium weitere 680 Mio. $.
Grenzen des Modells Kirchner
Die Teilprivatisierung von YPF ist eine verzweifelte Massnahme der Präsidentin zur Rettung des vom Ehepaar Kirchner verfochtenen Wirtschaftsmodells. Es ist an seine Grenzen gestossen. Die von Néstor Kirchner 2003 eingeleitete Wirtschaftspolitik hatte immer zur Bedingung, dass sowohl der Staatshaushalt als auch die Leistungsbilanz mit einem Überschuss abschliessen. Nur so konnte es sich Argentinien leisten, sich um seine internationalen Gläubiger zu foutieren und eine autonome Wirtschaftspolitik zu betreiben. Denn auf dem internationalen Kapitalmarkt kann das Land als Folge des immer noch nicht vollständig gelösten Defaults von 2001 höchstens zu prohibitiv hohen Zinsen Kapital aufnehmen.
Die Folgen der jahrelangen marktfremden Wirtschaftspolitik des Ehepaares Kirchner werden inzwischen immer sichtbarer. Letztes Jahr rutschte der Staatshaushalt erstmals klar ins Defizit, während die Leistungsbilanz nur noch einen geringfügigen Überschuss aufwies. Die Verschlechterung der Aussenbilanz war nicht zuletzt auf die stark wachsenden Energieimporte (besonders Erdgas) zurückzuführen. Diese stiegen in den letzten Jahren enorm an, da Preiskontrollen und andere interventionistische Massnahmen der Regierung die Erdöl- und Erdgasförderung in Argentinien uninteressant gemacht hatten. Die Aufwendungen für Energieimporte, die bereits 2010 mit 4,3 Mrd. $ einen Höchststand erreicht hatten, verdoppelten sich 2011 auf 9,3 Mrd. $; für das laufende Jahr wird gar mit 12 Mrd. $ gerechnet. Diese Entwicklung liess sich zweifellos nicht mehr lange aufrechterhalten. Statt die Bedingungen im Erdöl- und Erdgassektor für ausländische Investoren attraktiver zu gestalten, setzt die Präsidentin nun auf Kontrolle durch den Staat. Nun, da die ausländischen Investoren durch die grobe Enteignung von Repsol erst recht abgeschreckt werden, kann man nur rätseln, wo in Zukunft die Mittel für die notwendigen Investitionen herkommen sollen.
Angesichts der bedrohlichen Entwicklung bei Staatshaushalt und Leistungsbilanz begann die Präsidentin gleich nach ihrem Wahlsieg vom Oktober mit einschneidenden interventionistischen Massnahmen, mit denen sie die wachsenden Ungleichgewichte zu korrigieren hoffte. In der Sprache der Regierung handelt es sich bei dieser Art von Interventionen um Fine-Tuning ihres Wirtschaftsmodells. Seit November dürfen Dollars - in geringen Mengen - nur noch mit der Zustimmung des Steueramtes gekauft werden. Dieses hat für jeden Steuerpflichtigen nach intransparenten Regeln einen Maximalbetrag festgelegt. Gleichzeitig verfügte die Präsidentin eine starke Beschneidung der Subventionen auf Elektrizität, Gas und Wasser sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese an und für sich sinnvolle Massnahme wurde allerdings erratisch und die Rechtsgleichheit verletzend implementiert.
Sodann wurden Anfang Februar die Importe weiter erschwert. Für jede Einfuhr muss seither im Voraus eine zusätzliche Bewilligung bei der Regierung eingeholt werden. Die Situation am Zoll, wo Einfuhren von der Regierung schon bisher teilweise monatelang verzögert worden waren, ist für viele Unternehmen unerträglich geworden. Noch schlimmer war die Abänderung der Statuten der Zentralbank des Inhalts, dass die Regierung im grossen Stil auf die Reserven zugreifen kann.
Selbstgemachter Teufelskreis
Eine so weitgehende Verstaatlichungswelle wie in Venezuela ist in Argentinien zurzeit nicht zu erwarten. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Fernández de Kirchner nach dem Beispiel von Hugo Chávez auch Agrarland, Immobilien oder Supermärkte verstaatlichen möchte. Ihre Interventionen, wenn auch teilweise ideologisch begründet, entspringen in erster Linie ihrem verzweifelten Bemühen, die durch ihre interventionistische Politik geschaffenen wirtschaftlichen Probleme mit noch mehr Interventionismus zu bekämpfen.
Nach den jüngsten Erfahrungen bestehen aber kaum Zweifel, dass die Präsidentin zu neuen konfiskatorischen Massnahmen Zuflucht nehmen wird, wenn sie dies als notwendig erachtet, um ihr «Modell» am Leben zu erhalten. Die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses, die sie bei den Wahlen im Oktober errungen hat, gibt ihr dazu weitgehend freie Hand. Gefährdet dürften in erster Linie strategische Sektoren sein. Nicht von ungefähr kamen diese Woche Titel argentinischer Strom- und Gasverteiler und sogar Bankaktien an der New Yorker Börse unter Druck.
Weitere Interventionen der Präsidentin zeichnen sich ab: In einer unverhüllten Drohung an die Unternehmer forderte sie ihren Sekretär für Binnenhandel öffentlich dazu auf, etwas gegen die hohen Preise für Yerba Mate, den Rohstoff für das in Argentinien beliebte Aufgussgetränk, vorzukehren.
Wie immer Quelle: NZZ
Kirchner in den Fussstapfen von Hugo Chávez
Argentiniens Regierung wechselt von Fine-Tuning zu kruden Staatseingriffen
Mit zunehmendem Interventionismus versucht Argentiniens Präsidentin, ihr Wirtschaftsmodell zu retten. Die Zukunft des teilverstaatlichten Erdölkonzerns YPF ist mit Fragezeichen behaftet.
Werner Marti, Buenos Aires
Mit der zum Wochenbeginn von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner angekündigten Teilverstaatlichung von YPF, dem grössten argentinischen Erdölkonzern, übernimmt der argentinische Staat zusammen mit den Erdölprovinzen 51% der Aktien des Unternehmens. YPF fällt damit zwanzig Jahre nach der Privatisierung wieder zurück an den Staat. Der 51%-Anteil wird in seiner Gesamtheit vom spanischen Erdölkonzern Repsol, der bisher eine Aktienmehrheit von 57,4% besessen hatte, enteignet. Die Interessen der übrigen Aktionäre - die Unternehmerfamilie Eskenazi hält via Grupo Petersen 25,4%, der Rest wird an der Börse gehandelt - werden nicht angetastet.
Übernahme im Handstreich
Repsol hat inzwischen eine Entschädigung von 10,5 Mrd. $ verlangt. Die Börsenkapitalisierung von YPF Ende Januar vor Beginn der Kampagne der Regierung gegen das Unternehmen lag bei 17 Mrd. $. Die Regierung hat die Forderung von Repsol zurückgewiesen und erklärt, bei der Festsetzung der Kompensation würden die fehlenden Investitionen in YPF berücksichtigt. YPF ist bereits in fester Hand der Regierung, obwohl das Gesetz zur Verstaatlichung im Kongress noch nicht verabschiedet worden ist.
Die Präsidentin hat kurzerhand auch die sofortige Zwangsverwaltung von YPF dekretiert. Noch während sie über die nationalen Fernsehsender die Teilverstaatlichung bekanntgab, übernahmen im noblen früheren Hafenviertel Puerto Madero Vertreter der Regierung den Hauptsitz des Unternehmens und räumten laut Presseberichten zwanzig Mitgliedern der Unternehmensführung ganze 15 Minuten Zeit ein, um das Gebäude mit ihren wichtigsten Habseligkeiten zu verlassen. Bis auf weiteres wird YPF jetzt von Planungsminister de Vido sowie vom stellvertretenden Wirtschaftsminister Kicillof geleitet. Der Planungsminister wird in Argentinien von vielen für die gegenwärtige Energiekrise verantwortlich gemacht. Der 40-jährige Kicillof, der in der konservativen Tageszeitung «La Nación» kürzlich als Marxist bezeichnet wurde, hat keine Erfahrung auf dem Erdölbereich. Er ist aber einer der einflussreichsten Berater der Präsidentin. Jüngst hatte diese proklamiert, YPF werde in Zukunft professionell geführt werden.
Wie sich immer klarer zeigt, geht der Schaden der Teilprivatisierung weit über die direkt betroffene Repsol hinaus. Die YPF-Aktien wurden in New York am Mittwoch nach zweitägigem Unterbruch wieder gehandelt und verloren 32,7%. Das Papier hat somit seit Ende Januar, als die Kampagne der Regierung begann, rund 70% seines Werts eingebüsst. Dies trifft insbesondere auch eine Reihe von institutionellen Anlegern aus den USA hart, was wohl erklärt, weshalb Washington nach anfänglich lauer Reaktion seinen Ton verschärft hat. Das Länderrisiko Argentinien hat am Mittwoch die Grenze von 1000 Basispunkten überschritten; der Zinszuschlag auf argentinischen Staatspapieren im Vergleich mit amerikanischen Treasury-Bonds stieg mit anderen Worten auf 10,5 Prozentpunkte.
Schwer in Bedrängnis kommt auch die argentinische Familie Eskenazi, die über den Grupo Petersen 25,4% der YPF-Aktien hält. Unter starkem Druck von Präsident Néstor Kirchner trat Repsol in zwei Schritten 2008 und 2010 diesen Anteil an die Eskenazi-Familie ab. Zur Finanzierung der Übernahme nahm diese Kredite in der Höhe von 3,4 Mrd. $ zu gleichen Teilen bei Repsol und bei einem internationalen Bankenkonsortium auf, dem gemäss der «Nación» auch die Credit Suisse angehören soll. Den Schuldendienst bezahlten sie jeweils aus den Dividenden von YPF. Nachdem die Regierung nun angekündigt hat, dass für 2011 keine Dividende ausbezahlt werde, weil man in das Unternehmen reinvestieren solle, befindet sich der Grupo Petersen in akuter Konkursgefahr. Sie schuldet Repsol laut Bloomberg noch 1,9 Mrd. $ und dem internationalen Bankenkonsortium weitere 680 Mio. $.
Grenzen des Modells Kirchner
Die Teilprivatisierung von YPF ist eine verzweifelte Massnahme der Präsidentin zur Rettung des vom Ehepaar Kirchner verfochtenen Wirtschaftsmodells. Es ist an seine Grenzen gestossen. Die von Néstor Kirchner 2003 eingeleitete Wirtschaftspolitik hatte immer zur Bedingung, dass sowohl der Staatshaushalt als auch die Leistungsbilanz mit einem Überschuss abschliessen. Nur so konnte es sich Argentinien leisten, sich um seine internationalen Gläubiger zu foutieren und eine autonome Wirtschaftspolitik zu betreiben. Denn auf dem internationalen Kapitalmarkt kann das Land als Folge des immer noch nicht vollständig gelösten Defaults von 2001 höchstens zu prohibitiv hohen Zinsen Kapital aufnehmen.
Die Folgen der jahrelangen marktfremden Wirtschaftspolitik des Ehepaares Kirchner werden inzwischen immer sichtbarer. Letztes Jahr rutschte der Staatshaushalt erstmals klar ins Defizit, während die Leistungsbilanz nur noch einen geringfügigen Überschuss aufwies. Die Verschlechterung der Aussenbilanz war nicht zuletzt auf die stark wachsenden Energieimporte (besonders Erdgas) zurückzuführen. Diese stiegen in den letzten Jahren enorm an, da Preiskontrollen und andere interventionistische Massnahmen der Regierung die Erdöl- und Erdgasförderung in Argentinien uninteressant gemacht hatten. Die Aufwendungen für Energieimporte, die bereits 2010 mit 4,3 Mrd. $ einen Höchststand erreicht hatten, verdoppelten sich 2011 auf 9,3 Mrd. $; für das laufende Jahr wird gar mit 12 Mrd. $ gerechnet. Diese Entwicklung liess sich zweifellos nicht mehr lange aufrechterhalten. Statt die Bedingungen im Erdöl- und Erdgassektor für ausländische Investoren attraktiver zu gestalten, setzt die Präsidentin nun auf Kontrolle durch den Staat. Nun, da die ausländischen Investoren durch die grobe Enteignung von Repsol erst recht abgeschreckt werden, kann man nur rätseln, wo in Zukunft die Mittel für die notwendigen Investitionen herkommen sollen.
Angesichts der bedrohlichen Entwicklung bei Staatshaushalt und Leistungsbilanz begann die Präsidentin gleich nach ihrem Wahlsieg vom Oktober mit einschneidenden interventionistischen Massnahmen, mit denen sie die wachsenden Ungleichgewichte zu korrigieren hoffte. In der Sprache der Regierung handelt es sich bei dieser Art von Interventionen um Fine-Tuning ihres Wirtschaftsmodells. Seit November dürfen Dollars - in geringen Mengen - nur noch mit der Zustimmung des Steueramtes gekauft werden. Dieses hat für jeden Steuerpflichtigen nach intransparenten Regeln einen Maximalbetrag festgelegt. Gleichzeitig verfügte die Präsidentin eine starke Beschneidung der Subventionen auf Elektrizität, Gas und Wasser sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese an und für sich sinnvolle Massnahme wurde allerdings erratisch und die Rechtsgleichheit verletzend implementiert.
Sodann wurden Anfang Februar die Importe weiter erschwert. Für jede Einfuhr muss seither im Voraus eine zusätzliche Bewilligung bei der Regierung eingeholt werden. Die Situation am Zoll, wo Einfuhren von der Regierung schon bisher teilweise monatelang verzögert worden waren, ist für viele Unternehmen unerträglich geworden. Noch schlimmer war die Abänderung der Statuten der Zentralbank des Inhalts, dass die Regierung im grossen Stil auf die Reserven zugreifen kann.
Selbstgemachter Teufelskreis
Eine so weitgehende Verstaatlichungswelle wie in Venezuela ist in Argentinien zurzeit nicht zu erwarten. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Fernández de Kirchner nach dem Beispiel von Hugo Chávez auch Agrarland, Immobilien oder Supermärkte verstaatlichen möchte. Ihre Interventionen, wenn auch teilweise ideologisch begründet, entspringen in erster Linie ihrem verzweifelten Bemühen, die durch ihre interventionistische Politik geschaffenen wirtschaftlichen Probleme mit noch mehr Interventionismus zu bekämpfen.
Nach den jüngsten Erfahrungen bestehen aber kaum Zweifel, dass die Präsidentin zu neuen konfiskatorischen Massnahmen Zuflucht nehmen wird, wenn sie dies als notwendig erachtet, um ihr «Modell» am Leben zu erhalten. Die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses, die sie bei den Wahlen im Oktober errungen hat, gibt ihr dazu weitgehend freie Hand. Gefährdet dürften in erster Linie strategische Sektoren sein. Nicht von ungefähr kamen diese Woche Titel argentinischer Strom- und Gasverteiler und sogar Bankaktien an der New Yorker Börse unter Druck.
Weitere Interventionen der Präsidentin zeichnen sich ab: In einer unverhüllten Drohung an die Unternehmer forderte sie ihren Sekretär für Binnenhandel öffentlich dazu auf, etwas gegen die hohen Preise für Yerba Mate, den Rohstoff für das in Argentinien beliebte Aufgussgetränk, vorzukehren.
Wie immer Quelle: NZZ